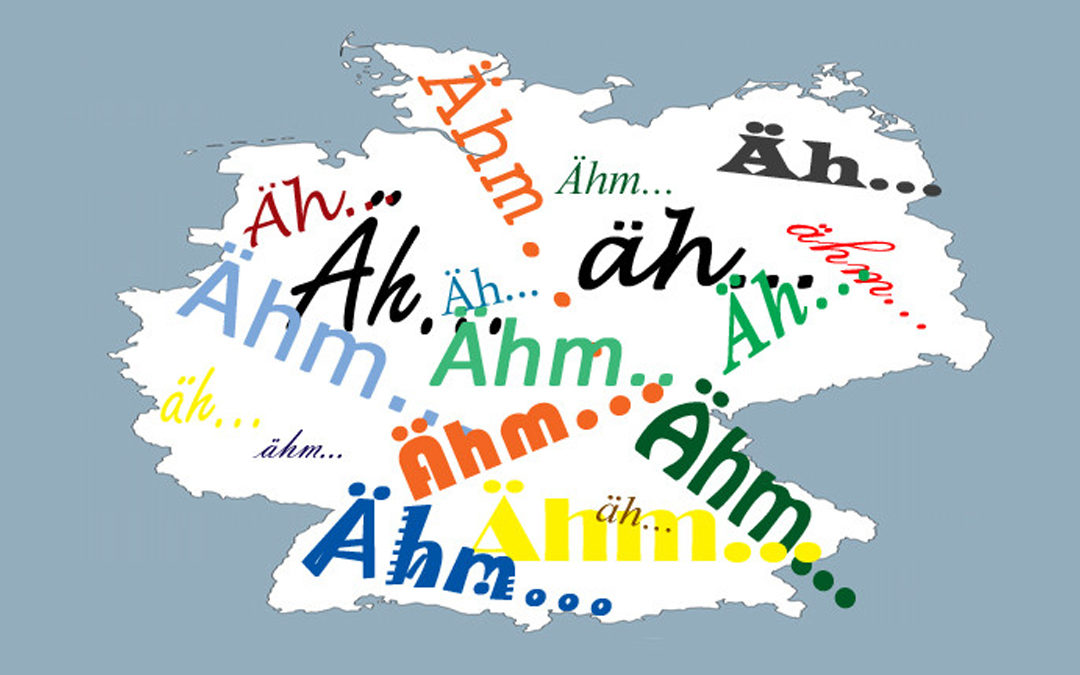Füllwörter wie «äh» oder «weisst du» galten selbst in der Sprachwissenschaft lange als überflüssig und bedeutungslos. Nun ist der Sozialpsychologe James Pennebaker überzeugt, dass sich damit Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen lassen.
James Pennebaker ist ein Mann der kleinen Worte. Andere mögen sich von imposanten Verben und Adjektiven einnehmen lassen, davon, dass es rauscht und prasselt und zerbirst, von Begriffen wie «butterzart» und «Abrissbirne». Der amerikanische Sozialpsychologe aber beschäftigt sich lieber mit den Wörtchen, die wir dabei übersehen.
Deshalb hat er zum Beispiel ein Buch über Pronomen geschrieben und herausgefunden, dass es einiges über uns aussagt, welche wir wie oft benutzen. Und ebenso hat er sich irgendwann gefragt, ob unsere Füllwörter «äh», «ähm» und «weisst du» in Gesprächen vielleicht ebenfalls mehr verraten, als uns bewusst ist. Die Linguistik hat sich zwar auch schon mit Füllwörtern beschäftigt, dabei ging es aber meist um deren Funktion. Was aber, wenn sich dank diesen Rückschlüsse auf Geschlecht, Alter oder gar Charaktereigenschaften einer Person ziehen liessen? Die Medizinstudentin Charlyn Laserna, der Psychologe Yi-Tai Seih und eben James Pennebaker wollten es herausfinden.
Zeit gewinnen und Bestätigung einholen
Mehrere Tage lang zeichneten sie für eine Studie im «Journal of Language and Social Psychology» Alltagsgespräche von Frauen und Männern unterschiedlichen Alters auf. Die Füllwörter, auf die sie sich konzentrierten, liessen sich in zwei Gruppen aufteilen: Hesitations- oder Verzögerungssignale beziehungsweise gefüllte Pausen und sogenannte Diskursmarker.
Zu Ersteren zählen Laute wie «uh» und «um» (denen auf Deutsch «äh» und «ähm» entsprechen), die dem Zuhörer vermitteln, dass der Redende gerade einen Moment Zeit braucht, um seine Gedanken zu ordnen, oder dass er verhindern möchte, dass die Sprecherrolle ans Gegenüber geht. Die zweite Gruppe, Formulierungen wie «I mean», «you know» oder «like» («ich meine» oder «weisst du»), kündigen an, dass man bereits Formuliertes noch einmal abwandeln will, sie fordern die Bestätigung ein, dass der andere einen auch sicher verstanden hat, und man hält sich mit ihnen ein Türchen offen, um nicht ganz auf das Gesagte festgelegt zu werden.
Wörtchen für Gewissenhafte
Die drei Wissenschafter der Universität Texas in Austin stellten fest: Junge Menschen und Frauen greifen in Gesprächen häufiger auf Formulierungen wie «I mean» oder «like» zurück als Männer und ältere Studienteilnehmer, ebenso Personen, die in einem Persönlichkeitstest hohe Werte beim Faktor Gewissenhaftigkeit erzielt haben. Die Autoren vermuten, dass gewissenhafte Menschen umsichtiger seien als andere, sich und ihr Umfeld bewusster wahrnähmen und deshalb auch häufiger ihre Gedanken mit anderen teilen wollten.
Bei «uh» und «um» fanden die Autoren hingegen keinen Zusammenhang mit bestimmten Charaktereigenschaften; dies erstaunte sie, würden solche Verzögerungen im Alltag doch oft als Zeichen von Unsicherheit oder Ängstlichkeit eines Menschen interpretiert. Auch Geschlechterunterschiede gab es hier keine, einzig das Alter spielte eine Rolle: Ältere Menschen überbrückten Sätze öfter mit diesen Lauten als jüngere Studienteilnehmer.
Situationen bestimmen Sprachmittel
Solchen Schlüssen steht der deutsche Sprachwissenschafter Hardarik Blühdorn skeptisch gegenüber – einen Zusammenhang mit Charaktereigenschaften hält er sogar für höchst unwahrscheinlich. «Welche Sprachmittel jemand benutzt, hängt viel mehr von der Situation ab als von persönlichen Merkmalen», meint Blühdorn, der sich am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim auf das Arbeitsgebiet Funktionswörter spezialisiert hat.
Egal, ob Mann oder Frau, jung oder alt, wir alle formulierten schliesslich an einer Prüfung oder in einem Vorstellungsgespräch unsere Gedanken vorsichtiger, dächten länger nach und überbrückten Pausen häufiger mit «äh» oder «ähm» als bei einem Abendessen mit Freunden. «Die Persönlichkeit mag einen Einfluss auf die Wahl bestimmter Gesprächsthemen und damit verbundene Inhaltswörter haben», sagt Blühdorn, «aber nicht auf Funktionswörter». In einem sind sich Psychologie und Sprachwissenschaft aber einig: Überflüssig sind die kleinen Wörtchen mitnichten.
Quelle: https://www.nzz.ch/panorama/was-kleine-woertchen-alles-ueber-uns-verraten-sag-mir-dein-aehm-ld.147589